Auch 1950 feiert die katholische Welt ein Heiliges Jahr. Doch: Es steht unter ganz anderen Vorzeichen als das Heilige Jahr 2025.
Jubiläen sind Anlass zum Feiern. Das ist auch bei Heiligen Jahren so, den Jubiläumsjahren der Kirche. Doch in dem Gebet zum Heiligen Jahr 1950, das Papst Pius XII. (1876-1958) formuliert, kommt wenig Feierstimmung auf. Im Gegenteil: Er schreibt von schwerer Schuld und tiefem Elend. Das „Geschenk des Heiligen Jahres“ solle daher vor allem eine Möglichkeit zu Reinigung und Sühne sein. Der Papst stellt es sich vor, als „das Jahr der großen Rückkehr und des großen Verzeihens“.
Das Jubiläum fällt in eine besondere Zeit
Nun ist der Aspekt der Vergebung immer schon fester Bestandteil der Heiligen Jahre: wer nach Rom pilgert und die Heiligen Pforten an Petersdom, Lateranbasilika, St. Paul vor den Mauern und Santa Maria Maggiore durchschreitet, erlangt den Ablass – die Vergebung der zeitlichen Sündenstrafen. Doch Pius XII. betont die Vergebung in seinem Gebet stärker als üblich. Was kann der Grund dafür sein?
Diese Frage klärt sich, wenn man darauf schaut, was das Jahr 1950 ausmacht: In Paderborn feiern die Gläubigen zum zweiten Mal im wiederaufgebauten Dom Libori. In Bielefeld entstehen Gebäude im Stil der Nachkriegsmoderne, die das Bild der Innenstadt bis heute prägen. In Dortmund glühen die Hochöfen. Bergleute, deren Kleidung von Kohlenstaub bedeckt ist, fahren im ganzen Ruhrgebiet unter Tage. Die Städte wachsen, weil Zehntausende Geflüchtete und Vertriebene in den Westen Deutschlands ziehen. 1950 – die Zeit des Wirtschaftswunders.
Verletzte Städte – verletzte Menschen
Und doch stehen die Städte und Orte im Erzbistum Paderborn, steht Deutschland, steht die ganze Welt noch unter dem Eindruck der Menschheitskatastrophen des Zweiten Weltkriegs und der Shoa. Auch fünf Jahre nach dem Ende des Krieges sprechen die an vielen Stellen noch sichtbaren Bombenkrater in den Stadtbildern eine deutliche Sprache. Und finden ihr Pendant in den körperlichen und seelischen Wunden der Menschen. Wie mit dieser großen Verletztheit umgehen? Wie die Trennlinien und Gräben überwinden, die Menschen zwischen Menschen gezogen hatten? Für Papst Pius XII. gibt es nur einen Weg: den der Reue und der Bitte um Vergebung. Deshalb stellt er das so prominent an den Anfang seines Gebetes.
Aus heutiger Perspektive ist ausgerechnet dieser Pius XII. nicht unumstritten. Öffentlich formuliert insbesondere Ralf Hochhuths Theaterstück „Der Stellvertreter“ 1963 die Kritik: der Papst habe im Zweiten Weltkrieg geschwiegen und zu zögerlich gehandelt – vor allen im Kontext der Shoa. Darf so ein Pius XII. überhaupt zu Umkehr und Verzeihen aufrufen? Klingt das nicht anmaßend? Weiterlesen

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt

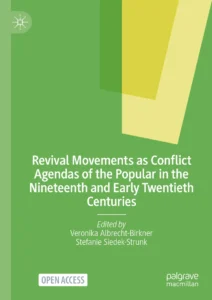 „Diese
„Diese  „Ein neues Internet-Angebot der Historischen Kommission für Westfalen ist online: Unser „Netzwerks zur Erforschung der jüdischen Geschichte in Westfalen und Lippe“ hat einen eigenen Internetauftritt erhalten. Die Seite ist erreichbar unter:
„Ein neues Internet-Angebot der Historischen Kommission für Westfalen ist online: Unser „Netzwerks zur Erforschung der jüdischen Geschichte in Westfalen und Lippe“ hat einen eigenen Internetauftritt erhalten. Die Seite ist erreichbar unter: 

 Inhalt:
Inhalt: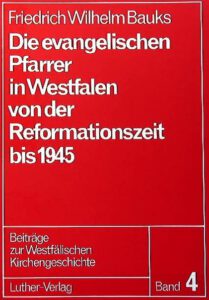 Das für die ragionale Geschichtsforschung immer noch einschhlägige Lexikon 1980 ist online:
Das für die ragionale Geschichtsforschung immer noch einschhlägige Lexikon 1980 ist online: