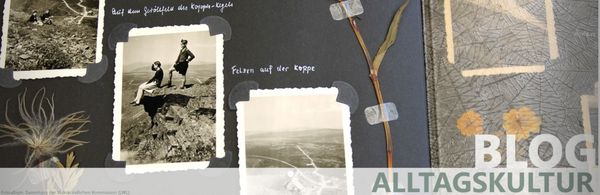Wie unsere Vorfahren mit Beobachtungen versuchten, das Wetter vorherzusagen
Am 2. Februar muss in Amerika am „Murmeltier-Tag“ wieder ein Nagetier als Wetterprophet für einen guten oder schlechten Frühling herhalten. In Westfalen gab es laut den Alltagskultur-Expert:innen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) früher auch eine tierische Wetterregel: „Sonnt sich der Dachs in der Lichtmesswoche, geht auf vier Wochen er wieder zu Loche“, heißt es in einer Bauernregel. „Hintergrund der Beobachtung war wohl, dass Dachse, die zwar keinen Winterschlaf, wohl aber Winterruhe halten, bei Sonnenschein und steigenden Temperaturen aus ihrem Bau kommen. Folgt der Schönwetterphase aber eine winterliche Witterung, suchen sie wieder Schutz in ihrem Bau“, erklärt Christiane Cantauw, wissenschaftliche Geschäftsführerin der Kommission Alltagskulturforschung beim LWL.

Der Dachs galt früher in Westfalen als Wetterprophet. Wenn die Tiere, wie hier in einer Inszenierung im LWL-Museum für Naturkunde in Münster, rund um den 2. Februar bei gutem Wetter aus dem Bau kamen, galt das als Hinweis, dass der Winter noch lange nicht vorbei ist.
Foto: LWL/Berenika Oblonczyk
Diese Bauernregel erinnert an den „Groundhog Day“, also den Murmeltier-Tag, der in einigen Städten der USA und Kanadas begangen wird. In einer publikumswirksamen Zeremonie wird an diesem Tag ein Murmeltier aus seinem Bau gelockt. Wirft es einen Schatten, was nur an einem sonnigen Tag möglich ist, so dauert der Winter angeblich noch vier weitere Wochen an. Immer wieder liest man, dass westfälische Einwanderer den „Murmeltiertag“ nach Amerika brachten. Da es dort den Grimbart nicht gibt, hätten sie ihn durch das Murmeltier als Wetterprophet ersetzt. „Ob der Murmeltiertag und die sich sonnenden Dachse mehr miteinander zu tun haben als die Beobachtung, dass auf eine sehr zeitige Gutwetterperiode Anfang Februar oft eine anhaltende Schlechtwetterperiode folgt, scheint mir eher unwahrscheinlich“, sagtdie Alltagskulturforscherin Cantauw. Weiterlesen

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt





 “ ….. Zudem möchte der Landrat jetzt ein Versprechen einlösen, das der Kreis vor 30 Jahren gegeben hat. Damals war unter Landrat Walter Nienhagen und Oberkreisdirektor Karlheinz Forster in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe ein Buch über die Backhäuser im Siegerland erarbeitet und veröffentlicht worden. Im Vorwort wurde angekündigt, dass ein zweiter Band mit den Backhäusern in Wittgenstein folgen soll. Dieser ist jedoch bis heute nicht erschienen. Allerdings hat Hans-Armin Kohlberger aus Bad Laasphe in den vergangenen Jahren in akribischer Arbeit Fotos und Geschichten der Wittgensteiner Backhäuser zusammengetragen. „Diese Fleißarbeit ist es Wert, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Deshalb ist der Heimatbund gerne bereit, als Herausgeber für dieses Buch zu fungieren“, kündigt Andreas Müller an: „Der 25. Geburtstag des Heimatbundes ist auch hier für uns ein wunderbarer Ansporn, dieses Buch jetzt engagiert zu verwirklichen. Es wäre klasse, wenn wir das bis spätestens zum ‚Fest der Dörfer‘ am 29. August nächsten Jahres hinbekommen. Wir werden zumindest unser Möglichstes versuchen.“
“ ….. Zudem möchte der Landrat jetzt ein Versprechen einlösen, das der Kreis vor 30 Jahren gegeben hat. Damals war unter Landrat Walter Nienhagen und Oberkreisdirektor Karlheinz Forster in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe ein Buch über die Backhäuser im Siegerland erarbeitet und veröffentlicht worden. Im Vorwort wurde angekündigt, dass ein zweiter Band mit den Backhäusern in Wittgenstein folgen soll. Dieser ist jedoch bis heute nicht erschienen. Allerdings hat Hans-Armin Kohlberger aus Bad Laasphe in den vergangenen Jahren in akribischer Arbeit Fotos und Geschichten der Wittgensteiner Backhäuser zusammengetragen. „Diese Fleißarbeit ist es Wert, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Deshalb ist der Heimatbund gerne bereit, als Herausgeber für dieses Buch zu fungieren“, kündigt Andreas Müller an: „Der 25. Geburtstag des Heimatbundes ist auch hier für uns ein wunderbarer Ansporn, dieses Buch jetzt engagiert zu verwirklichen. Es wäre klasse, wenn wir das bis spätestens zum ‚Fest der Dörfer‘ am 29. August nächsten Jahres hinbekommen. Wir werden zumindest unser Möglichstes versuchen.“