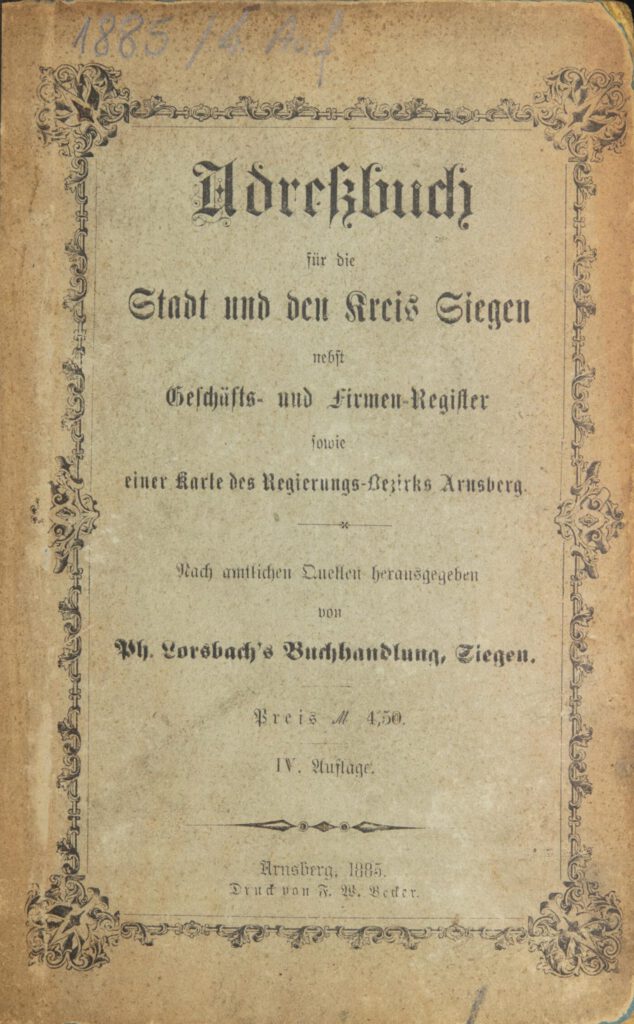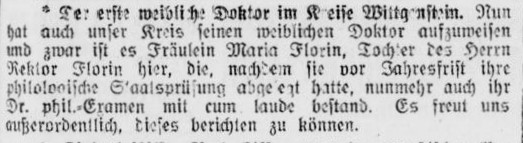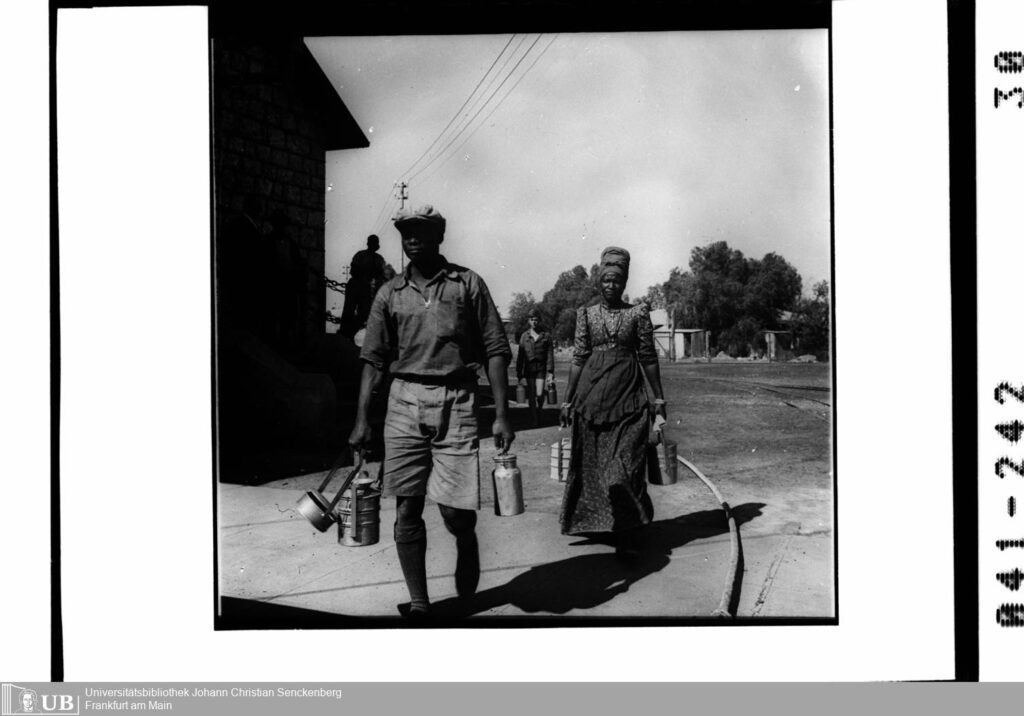Eine Imaginations- und Materialitätsgeschichte weiblich codierter Medientechnik von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart
Die 2024 an der Universität Siegen entstandene „Masterarbeit untersucht als Foucaultsche Diskursanalyse die Genealogie von digitalen Sprachassistenten am Beispiel von Siri. Sie stellt die Frage, wie und warum sich eine standardmäßig weibliche Codierung verschiedenster Medientechniken über die Jahre hinweg etablieren konnte und welche Rückschlüsse dies auf gesellschaftliche Machtstrukturen ermöglicht. Untersucht wird dazu die historische Entwicklung geschlechtlich codierter Medientechniken ab den 1960er Jahren anhand fünf exemplarisch ausgewählter Stationen: Fiktive Sprachassistenten in Film und Fernsehen der 60er Jahre, Sekretärinnen und Schreibmaschinen, Geldautomaten, Navigationssysteme und schließlich Siri. Die wechselseitige Produktion von Gender und Technik steht im Vordergrund und wird über Inhalts- und Werbeanalysen als Zugangspunkt erarbeitet, welche einerseits die Selbstdarstellung und andererseits die gewünschte Fremdwahrnehmung von Herstellern signalisieren und gleichzeitig zu gesellschaftlichen Werthaltungen beitragen. Die Arbeit kann zeigen, dass die weibliche Dienstbarkeit allen untersuchten Techniken als Gemeinsamkeit zugrunde liegt. Die Inszenierung von Weiblichkeit soll vor allem dazu dienen, die Hemmschwelle für Nutzer:innen zu senken; die Assoziation von Weiblichkeit mit Hilfsbereitschaft und Dienstbarkeit wird von Herstellern über Jahrzehnte hinweg aktiv (mit)erschaffen und durch moderne Medientechniken wie Sprachassistenten bis in die Gegenwart fortgeführt, ist also in hohem Maße sozial konstruiert.“
Link zur Publikationen

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt