„Dank der großzügigen Unterstützung durch den Förderverein des Siegerlandmuseums und des Oberen Schlosses e.V. ist es gelungen, ein detailgetreues Modell eines Handelsschiffes des 17. Jahrhunderts von einem US-amerikanischen Hersteller historischer Schiffsmodelle zu erwerben.

Das detailgetreue Modell eines Handelsschiffes des 17. Jahrhunderts hat das Siegerlandmuseum von einem US-amerikanischen Hersteller historischer Schiffsmodelle erworben. (Foto: Siegerlandmuseum)
Das Modell zeigt den typischen niederländischen Ost- bzw. Westindienfahrer, das heißt den Segelschifftyp, der von der niederländischen Ostindien- sowie der Westindien-Kompanie als Handelsschiff zwischen Europa und den überseeischen Kolonien eingesetzt wurde. Charakteristisch für diese Handelsschiffe sind die drei Masten, eine Bewaffnung mit mehreren Geschützen und ein hohes Schanzkleid zum Erschweren von Enterversuchen.
Auf einem solchen Segelschiff stach der 32-jährige Johann Moritz von Nassau-Siegen im Oktober 1636 von der Nordseeinsel Texel aus in See. Ziel der Reise war das im heutigen Brasilien gelegene Recife. Erst einige Jahre zuvor hatten die Vereinigten Niederlande im Zuge ihrer kolonialen Bestrebungen in Südamerika die Stadt und Region erobert und versuchten nun, ihren Einfluss zu festigen. Johann Moritz wurde zu diesem Zweck als Generalgouverneur nach Niederländisch-Brasilien entsandt.“
Quelle: Stadt Siegen, Pressemitteilung, 25.02.2022

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt


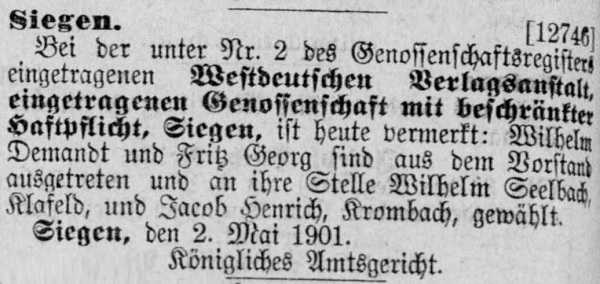

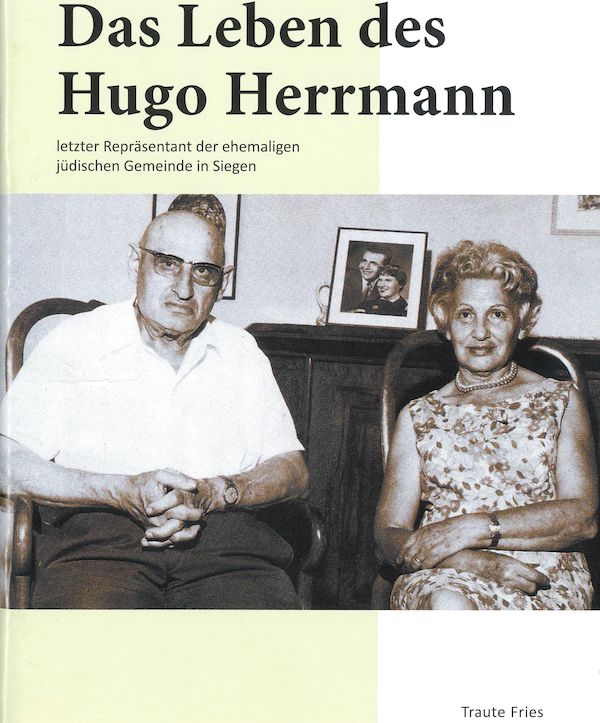
 Toller Erfolg für Prof. Dr. Reinhild Kreis vom Historischen Seminar der Universität Siegen: Sie ist in diesem Jahr Trägerin des Rita Süssmuth-Forschungspreises in der Kategorie „Forschung plus“. Das Land NRW würdigt mit der Auszeichnung exzellente Forschung mit Geschlechterbezug. Im Beisein der CDU-Politikerin und ehemaligen Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth überreichte NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen den Preis jetzt in Düsseldorf. Er wird in zwei verschiedenen Kategorien vergeben: Die Kategorie „Forschung plus“ ist mit 50.000 Euro dotiert, die Kategorie „Impulse“ mit 25.000 Euro – sie geht in diesem Jahr an die Soziologin Dr. Barbara Umrath von der Technischen Hochschule Köln.
Toller Erfolg für Prof. Dr. Reinhild Kreis vom Historischen Seminar der Universität Siegen: Sie ist in diesem Jahr Trägerin des Rita Süssmuth-Forschungspreises in der Kategorie „Forschung plus“. Das Land NRW würdigt mit der Auszeichnung exzellente Forschung mit Geschlechterbezug. Im Beisein der CDU-Politikerin und ehemaligen Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth überreichte NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen den Preis jetzt in Düsseldorf. Er wird in zwei verschiedenen Kategorien vergeben: Die Kategorie „Forschung plus“ ist mit 50.000 Euro dotiert, die Kategorie „Impulse“ mit 25.000 Euro – sie geht in diesem Jahr an die Soziologin Dr. Barbara Umrath von der Technischen Hochschule Köln.