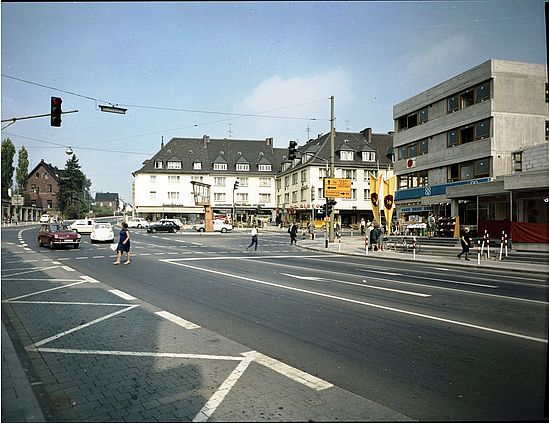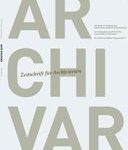“ …. Die Chance, einen Orden zu bekommen, war 1966 weit geringer als zehn Jahre früher. Auch Heuss lehnte es zwar ab, das Bundesverdienstkreuz dem Großindustriellen und Milliardär Flick zu verleihen, weil er den nicht für einen „schöpferischen Unternehmen“, sondern für einen „Händler mit Aktienpaketen“ hielt und der Orden nicht für das Verdienen, sondern für Verdienste gegeben werde. ….“ aus: Walter Henkels: Adenauers gesammelte Bosheiten. Eine anekdotische Nachlese, Düsseldorf 1983, S. 136
Kim Christian Priemel zieht in seiner Monographie „Flick. Eine Konzerngeschichtevom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik“, Göttingen 2007, S. 759, zur Darstellung der Ordensverleihung neben Presseartikeln (z. B. Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 107.1963) auch Klaus Gotto (Bearb.): Im Zentrum der Macht. Das Tagebuch von Staatssekretär Lenz, 1951–1953. Düsseldorf 1989, heran und verweist auf dem Tagebucheintrags Lenz´vom 22./23.9.1953.
In Norbert Frei/ Ralf Ahrens/Jörg Osterloh/Tim Schanetzky: „Flick. Der Konzern, die Familie, die Macht.“, München 2009, S. 641, fusst die Darstellung der Ordensverleihung auf die im Landesarchiv NRW aufbewahrte Ordensakte mit der Signatur LA NRW, NW O-5807. Diesen Aktenband zieht die bislang umgangreichste Darstellung der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Friedrich Flick ebenfalls zu Rate – neben der einschlägigen Überlieferung des Bundespräsidialamtes im Koblenzer Bundesarchiv (Bestand 122).
In der biographischen Quellen und der entsprechenden Literatur zu Adenauer, Heuss, Erhard und Lübke sollten sich ebenfalls weitere Hinweise zur Ordensangelegeneheit Flick finden. Eine abschließende Erforschung des zehn Jahre dauernden Verfahrens stellt bis jetzt ein Forschungsdesiderat dar.


 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt