Zeitzeugin: Cornelie Rothmaler-Schön
Inhalt: Weiterlesen

Zeitzeugin: Cornelie Rothmaler-Schön
Inhalt: Weiterlesen

Die Tagebücher der in Siegen-Weidenau praktizierenden Hebamme Grete Kottenhoff (Jg. 1901) wurde dem Kreisarchiv am 2. April 2025 von privater Hand übergeben. Die Tagebücher reichen von 1937 bis 1954 lückenlos und dokumentieren die von der Hebamme betreuten Geburten. Kottenhoff war nach dem 2. Weltkrieg bis 1962 Kreishebamme (=Vorsitzende der Kreishebammenvereins des Siegerlandes).
Die Tagebücher dokumentieren den Geburtsverlauf und den Verlauf der Wöchnerinnenphase. Unregelmäßig ist die Sichtung der Tagebücher durch das Gesundheitsamt des dokumentiert; bis 1945 erscheinen Unterschriften von Dr. Wihelm Klein, nach 1945 von Dr. Wilhelm Pieper. Die vereinzelt vorhandenen Statistiken bilden den Grundstock für eine stastitische Auswertung des Bestandes, demaufgrund des Überlieferungszeitraumes einen regionalen medizinhistorischen Wert zu zumessen ist. Zudem dürften auch familiengeschichtliche Forschungen auf den Bestand zurückgreifen.
Zur Biographie Kottenhoffs wird auf eine Auswertung der lokalen Presse sowie auf die vorhandene Entazifizierungsakte im Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland NW 1111-BG. 34 (SBE Hauptausschuss Landkreis Siegen), Nr. 181, hingewiesen.
Der Bestand erhielt die Signatur 3.32. Die 20 Archiveinheiten wurden verzeichnet und verpackt. Eine Nutzung ist erst nach Ablauf der Sperrfristen möglich.
„Das Schellenschmieden ist in Westfalen mittlerweile ein ausgestorbenes Handwerk. Wilhelm Krämer war der letzte Schellenschmied im SiegerSauerland – und vermutlich in ganz Westfalen! Im Dorf Grund bei Hilchenbach führte seine Familie über Generationen hinweg eine Schmiede, ausgezeichnet durch ihr Spezialwissen über das Schmieden von Vieh-Schellen. Mit Rückgang der Naturweidewirtschaft beendete die Familie im Jahr 1950 jedoch auch die Herstellung der Schellen. Die Aufnahmen aus 1959/60, die einen Einblick in die Schellenschmiede in Grund geben, sind daher inszeniert worden. Dieser Filmfassung ist eine Einführung aus 1996 vorangestellt, mit noch weiteren Informationen zur Geschichte und Tradition des Schellenschmiedens und zur Entstehung des Originalfilms.
In der Reihe „Filmschätze“ veröffentlicht das LWL-MEdienzentrum für Westfalen ausgewählte Dokumentar-, Kurz- und Amateurfilme vergangener Jahrzehnte in voller Länge auf YouTube. Charakteristisch für die Filmauswahl ist, dass die „Filmschätze“ Themen aus Westfalen in den Fokus rücken, aus ihrer Entstehungszeit heraus in den Blick nehmen und ein gewisses Zeitkolorit transportieren.“
Dreiteiliger Podcast des Bundesarchivs über Entschädigung, geraubtes Eigentum und Millionen von Akten
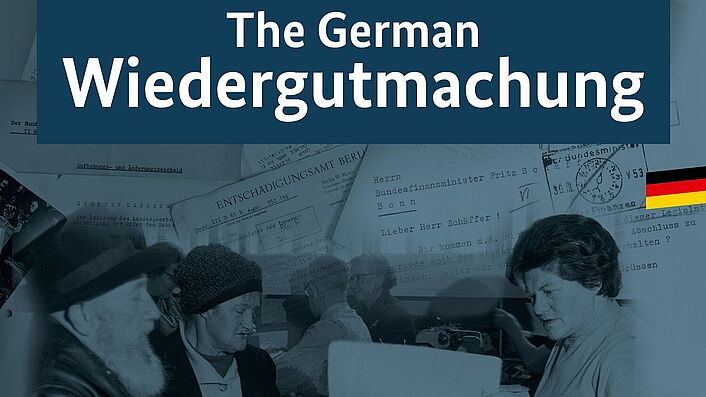
Wie hat die Bundesrepublik Deutschland die Opfer der beispiellosen NS-Verbrechen entschädigt? Wie wurde geraubtes Eigentum zurückgegeben? Und lassen sich begangene Verbrechen überhaupt „wieder gut machen“? Um diese und weitere Fragen geht es im neuen, dreiteiligen Podcast „The German Wiedergutmachung“, der jetzt online verfügbar ist. In drei Folgen stehen zentrale Aspekte der Wiedergutmachung wie Restitution und Entschädigung NS-Verfolgter sowie der Umgang mit den sogenannten „Vergessenen Opfer“ am Beispiel der Sinti und Roma im Mittelpunkt. Fachleute aus Wissenschaft und Gesellschaft beleuchten zusammen mit Podcast-Gastgeberin Nora Hespers, auch anhand historischer Dokumente aus dem Bundesarchiv, die Hintergründe der Wiedergutmachung. Der Podcast erscheint in einer deutschen und einer englischen Version.
„The German Wiedergutmachung“ entstand im Auftrag des Bundesarchivs für das Online-Themenportal „Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts“.
Das vom Bundesministerium der Finanzen initiierte und vom Bundesarchiv konzipierte und gestaltete Themenportal bietet seit 2022 einen zentralen Zugang zu Millionen Akten der deutschen Wiedergutmachungspolitik und wird fortlaufend zu einem umfassenden Recherche- und Informationsort ausgebaut, der neben Archiv-Inhalten auch Hintergrundinformationen, Podcasts und Recherchehilfen bietet. Das Themenportal wird gemeinsam mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg, dem Leibniz-Institut FIZ Karlsruhe und dem Portal Deutsche Digitale Bibliothek umgesetzt.
Der neue Podcast erschient zum Jahrestag der Ratifizierung des Luxemburger Abkommen zur sogenannten „Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts“ am 18. März 1953. In diesem Abkommen übernahm die Bundesrepublik gegenüber dem Staat Israel die Verantwortung für die im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen, insbesondere an Jüdinnen und Juden. Weiterlesen
 Auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft „Ahnenforschung Wittgenstein“ wurden kürzlich Auflistungen der einzelnen Einträge folgender Heiratsnebenregisters des Standesamts Arfeld online verfügbar gemacht:
Auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft „Ahnenforschung Wittgenstein“ wurden kürzlich Auflistungen der einzelnen Einträge folgender Heiratsnebenregisters des Standesamts Arfeld online verfügbar gemacht:
Heiratsnebenregisters 1874 des Standesamts Arfeld aufgelistet
Heiratsnebenregister 1898 des Standesamts Arfeld aufgelistet
Heiratsnebenregister 1899 des Standesamts Arfeld aufgelistet
 Auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft „Ahnenforschung Wittgenstein“ wurden kürzlich Auflistungen der einzelnen Eintrage der Sterbenebenregister des Standesamtes Arfeld für die Jahre 1875 – 1879, 1910 – 1938 online verfügbar gemacht:
Auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft „Ahnenforschung Wittgenstein“ wurden kürzlich Auflistungen der einzelnen Eintrage der Sterbenebenregister des Standesamtes Arfeld für die Jahre 1875 – 1879, 1910 – 1938 online verfügbar gemacht:
Sterbenebenregister des Standesamtes Arfeld 1875
Sterbenebenregister des Standesamtes Arfeld 1876
Sterbenebenregister 1877 des Standesamts Arfeld aufgelistet
Sterbenebenregister 1878 des Standesamts Arfeld aufgelistet
Sterbenebenregister 1879 des Standesamts Arfeld aufgelistet
Sterbenebenregister 1910 des Standesamts Arfeld aufgelistet
Sterbenebenregister 1911 des Standesamts Arfeld aufgelistet Weiterlesen
Quelle: Dominic Eickhoff (13. März 2025). #WAT25: Archive und Cyberangriffe – Lücken vermeiden durch Vorsorge? archivamtblog. Abgerufen am 14. März 2025 von https://doi.org/10.58079/13go6
Auch 1950 feiert die katholische Welt ein Heiliges Jahr. Doch: Es steht unter ganz anderen Vorzeichen als das Heilige Jahr 2025.
Jubiläen sind Anlass zum Feiern. Das ist auch bei Heiligen Jahren so, den Jubiläumsjahren der Kirche. Doch in dem Gebet zum Heiligen Jahr 1950, das Papst Pius XII. (1876-1958) formuliert, kommt wenig Feierstimmung auf. Im Gegenteil: Er schreibt von schwerer Schuld und tiefem Elend. Das „Geschenk des Heiligen Jahres“ solle daher vor allem eine Möglichkeit zu Reinigung und Sühne sein. Der Papst stellt es sich vor, als „das Jahr der großen Rückkehr und des großen Verzeihens“.
Das Jubiläum fällt in eine besondere Zeit
Nun ist der Aspekt der Vergebung immer schon fester Bestandteil der Heiligen Jahre: wer nach Rom pilgert und die Heiligen Pforten an Petersdom, Lateranbasilika, St. Paul vor den Mauern und Santa Maria Maggiore durchschreitet, erlangt den Ablass – die Vergebung der zeitlichen Sündenstrafen. Doch Pius XII. betont die Vergebung in seinem Gebet stärker als üblich. Was kann der Grund dafür sein?
Diese Frage klärt sich, wenn man darauf schaut, was das Jahr 1950 ausmacht: In Paderborn feiern die Gläubigen zum zweiten Mal im wiederaufgebauten Dom Libori. In Bielefeld entstehen Gebäude im Stil der Nachkriegsmoderne, die das Bild der Innenstadt bis heute prägen. In Dortmund glühen die Hochöfen. Bergleute, deren Kleidung von Kohlenstaub bedeckt ist, fahren im ganzen Ruhrgebiet unter Tage. Die Städte wachsen, weil Zehntausende Geflüchtete und Vertriebene in den Westen Deutschlands ziehen. 1950 – die Zeit des Wirtschaftswunders.
Verletzte Städte – verletzte Menschen
Und doch stehen die Städte und Orte im Erzbistum Paderborn, steht Deutschland, steht die ganze Welt noch unter dem Eindruck der Menschheitskatastrophen des Zweiten Weltkriegs und der Shoa. Auch fünf Jahre nach dem Ende des Krieges sprechen die an vielen Stellen noch sichtbaren Bombenkrater in den Stadtbildern eine deutliche Sprache. Und finden ihr Pendant in den körperlichen und seelischen Wunden der Menschen. Wie mit dieser großen Verletztheit umgehen? Wie die Trennlinien und Gräben überwinden, die Menschen zwischen Menschen gezogen hatten? Für Papst Pius XII. gibt es nur einen Weg: den der Reue und der Bitte um Vergebung. Deshalb stellt er das so prominent an den Anfang seines Gebetes.
Aus heutiger Perspektive ist ausgerechnet dieser Pius XII. nicht unumstritten. Öffentlich formuliert insbesondere Ralf Hochhuths Theaterstück „Der Stellvertreter“ 1963 die Kritik: der Papst habe im Zweiten Weltkrieg geschwiegen und zu zögerlich gehandelt – vor allen im Kontext der Shoa. Darf so ein Pius XII. überhaupt zu Umkehr und Verzeihen aufrufen? Klingt das nicht anmaßend? Weiterlesen
Ein praktischer Leitfaden für die Notfallvorsorge in Kulturinstitutionen
Seit Ende 2024 ist das „Einsatzhandbuch Kulturgut“ online verfügbar. Das umfangreiche E-Book ist kostenfrei online abrufbar.
Das Handbuch ist ein umfassender Handlungsleitfaden, der alle Aspekte der Notfallbewältigung im Bereich Kulturgutschutz zusammenfasst. Mitarbeiter*innen und Verantwortliche in Archiven, Museen, Schlössern, Kirchen sowie Restaurator*innen profitieren von den praxisorientierten und leicht verständlichen Texten und Abbildungen.
Das Handbuch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Abschnitt stehen die Grundlagen des Kulturgutschutzes im Fokus. Es wird auf die Verfahren für die Bergung und Erstversorgung von Kulturgut eingegangen. Teil zwei beschreibt den Einsatzablauf vom Eintritt des Schadensereignisses, über die Feststellung der Lage und die Beurteilung der Situation. Weiterhin werden die Bergung, die Erstversorgung sowie die Nachsorge dargestellt. In Teil drei werden Empfehlungen zur fachgerechten Erstversorgung von Objekten unterschiedlicher Materialien gegeben. Archivgut, Fotografien, Gemälde und Holzobjekte sind als einige Beispiele zu nennen.
Der VDR als Berufs- und Fachverband vertritt rund 3.000 Restaurator*innen und steht für den Schutz und die sachgerechte Bewahrung von Kunst und Kulturgut ein.
Seit 2020 engagiert sich der VDR verstärkt im Bereich der Kulturgutrettung im Katastrophenfall und ist über seinen VDR-Arbeitsausschuss Kulturgutschutz mit zahlreichen Bündnispartnern vernetzt, mehr dazu finden Sie hier.
Quelle: Archive im Rheinlöand, 3.2.2025, Text: Anna Katharina Fahrenkamp

Das Landesarchiv NRW hat in diesem Januar das 89 Seiten starkenArchivierungsmodell „Städte- und Wohnungsbau der Projektgruppe „Wirtschaft“ vorgelegt.