Zeitzeugin: Cornelie Rothmaler-Schön
Inhalt: Weiterlesen

Zeitzeugin: Cornelie Rothmaler-Schön
Inhalt: Weiterlesen
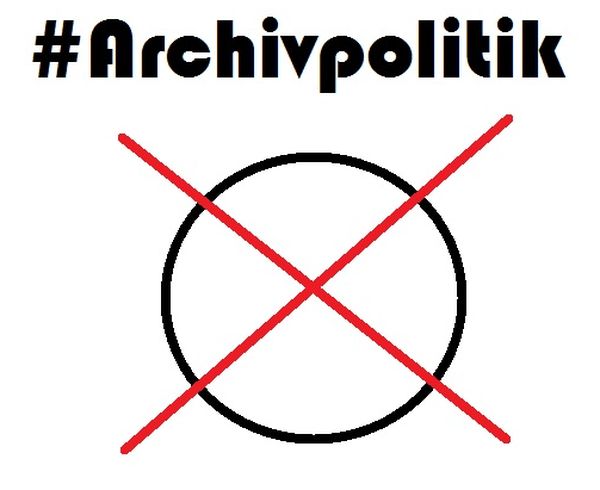 Siwiarchiv wirft einen Blick in den Koalitionsvertrag 2025 von CDU/CSU und SPD auf der Suche nach Archivischem – und (neu!) mit einem Exkurs zur Erinnerungskultur:
Siwiarchiv wirft einen Blick in den Koalitionsvertrag 2025 von CDU/CSU und SPD auf der Suche nach Archivischem – und (neu!) mit einem Exkurs zur Erinnerungskultur:
S. 121:
“ …. Digitalisierung und Standortentwicklung Bundesarchiv
Wir werden die Digitalisierung und die Standortentwicklung des Bundesarchivs mit seinen Außenstellen des Stasi-Unterlagen-Archivs vorantreiben. Auch positive Ereignisse und Orte der deutschen Demokratiegeschichte sind von hoher erinnerungspolitischer Bedeutung. Diese werden wir, wie auch die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte weiter fördern. ….“
Exkurs Erinnerungskultur, S. 121 – 122: Weiterlesen

Die Tagebücher der in Siegen-Weidenau praktizierenden Hebamme Grete Kottenhoff (Jg. 1901) wurde dem Kreisarchiv am 2. April 2025 von privater Hand übergeben. Die Tagebücher reichen von 1937 bis 1954 lückenlos und dokumentieren die von der Hebamme betreuten Geburten. Kottenhoff war nach dem 2. Weltkrieg bis 1962 Kreishebamme (=Vorsitzende der Kreishebammenvereins des Siegerlandes).
Die Tagebücher dokumentieren den Geburtsverlauf und den Verlauf der Wöchnerinnenphase. Unregelmäßig ist die Sichtung der Tagebücher durch das Gesundheitsamt des dokumentiert; bis 1945 erscheinen Unterschriften von Dr. Wihelm Klein, nach 1945 von Dr. Wilhelm Pieper. Die vereinzelt vorhandenen Statistiken bilden den Grundstock für eine stastitische Auswertung des Bestandes, demaufgrund des Überlieferungszeitraumes einen regionalen medizinhistorischen Wert zu zumessen ist. Zudem dürften auch familiengeschichtliche Forschungen auf den Bestand zurückgreifen.
Zur Biographie Kottenhoffs wird auf eine Auswertung der lokalen Presse sowie auf die vorhandene Entazifizierungsakte im Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland NW 1111-BG. 34 (SBE Hauptausschuss Landkreis Siegen), Nr. 181, hingewiesen.
Der Bestand erhielt die Signatur 3.32. Die 20 Archiveinheiten wurden verzeichnet und verpackt. Eine Nutzung ist erst nach Ablauf der Sperrfristen möglich.
“ …. Etwa sein Engagement für die Förderung von Nachlassarchiven für Bildende Kunst, angeregt vom Modellprojekt im Kloster Pulheim bei Köln. Hier leistet die Stiftung Kunstfonds Großartiges. Suttner ist überzeugt, dass insbesondere die Bildende Kunst eine wichtige regionale Überlieferung ist ….“
in: Andreas Kolb: Kultur Pur. Der Siegener Kultur-Ermöglicher Wolfgang Suttner im Porträt, in: Politik & Kultur | Nr. 04/25 | April 2025, S. 14
s. a. auf siwiarchiv
– Vortrag: „Das letzte Hemd hat keine Taschen… Wohin mit den Künstlernachlässen?“
– Wohin mit den regionalen Künstlernachlässen?
– Künstlervor- und –nachlässe in Deutschland
„Das Schellenschmieden ist in Westfalen mittlerweile ein ausgestorbenes Handwerk. Wilhelm Krämer war der letzte Schellenschmied im SiegerSauerland – und vermutlich in ganz Westfalen! Im Dorf Grund bei Hilchenbach führte seine Familie über Generationen hinweg eine Schmiede, ausgezeichnet durch ihr Spezialwissen über das Schmieden von Vieh-Schellen. Mit Rückgang der Naturweidewirtschaft beendete die Familie im Jahr 1950 jedoch auch die Herstellung der Schellen. Die Aufnahmen aus 1959/60, die einen Einblick in die Schellenschmiede in Grund geben, sind daher inszeniert worden. Dieser Filmfassung ist eine Einführung aus 1996 vorangestellt, mit noch weiteren Informationen zur Geschichte und Tradition des Schellenschmiedens und zur Entstehung des Originalfilms.
In der Reihe „Filmschätze“ veröffentlicht das LWL-MEdienzentrum für Westfalen ausgewählte Dokumentar-, Kurz- und Amateurfilme vergangener Jahrzehnte in voller Länge auf YouTube. Charakteristisch für die Filmauswahl ist, dass die „Filmschätze“ Themen aus Westfalen in den Fokus rücken, aus ihrer Entstehungszeit heraus in den Blick nehmen und ein gewisses Zeitkolorit transportieren.“
Donnerstag, 10. April 2025, 19:00 – 21:15 Uhr, Ehemaliges Haus der Kirche, Seminarraum U1 | Burgstraße 21 | 57072 Siegen
Referent: Gerhard Moisel, Archivar Ev. Kirchenkreis Siegen i.R.
Leitung: Heike Dreisbach, Erwachsenenbildung im Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein
Sie möchten mehr über Ihre Vorfahren herausfinden, wissen aber nicht, wie Sie diesen Wunsch praktisch umsetzen können? An diesem Abend erfahren Sie mehr. Sie erhalten einen Einblick in die Arbeitsweise und das Handwerkszeug der Genealogie (Forschungsgebiet, das sich mit der Herkunft von Verwandtschaftsverhältnissen befasst) und lernen, welche Hilfsmittel Sie einsetzen können und an welche Stellen Sie sich wenden müssen, um Zugang zu Kirchenbüchern und Archiven zu erhalten. Referent ist Gerhard Moisel, Historiker, langjähriger Archivar des Ev. Kirchenkreises Siegen.
Preis: kostenfrei. Um eine Anmeldung wird gebeten (begrenzte Platzkapazität).Kursnummer: 057 – 3675
Online | Mail: eeb@kirchenkreis-siwi.de | telefonisch 02739-8987839
Dr. Klaus Graf geht in den wohlverdienten Ruhestand. Ohne dessen frühes Engagement in den sozialen Medien – Archivalia startete bereits 2003 – hätte die deutsche Archivlandschaft sicher erst viel später die Möglichkeiten der sozialen Medien genutzt. siwiarchiv begann bspw. erst im Jahr 2012 nach einer wichtigen Lernphase bei Archivalia. Daher: vielen Dank bis hier hin und ad multos annos!
Die beiden kommunalen Archive in Siegen leiden unter erheblichen Raumproblemen. Im Stadtarchiv ist das Dach probelmatisch und die Bergung im Brandfall herausfordernd, das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein ist durch die Trennung der Funktionsbereiche auf 2 Orte stark gehandicapt.
Die optimale Lösung dieser Probleme ist ein Archivverbund, d.h. mehrere Archive werden unter einem Dach untergebracht. Idealerweise beteiligen sich nicht nur das Stadtarchiv Siegen und das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, sondern außerdem das Universitätsarchiv und eine Abteilung des Landesarchivs NRW. Die Vorteile für alle Beteiligten liegen auf der Hand:
1. Von der Einbindung eines staatlichen Archivs geht eine kaum zu unterschätzende Belebung der Regionalgeschichte aus. Die Überlieferungen des Fürstentums Nassau-Siegen, der Wittgensteiner Grafschaften, der Landratsämter und der Kreise Siegen und Wittgenstein (bisher in Münster archiviert) können in Siegen eingesehen werden und der Archivverbund wird zwangsläufig zu einem Zentrum der Regionalgeschichte, zu einer Anlaufstelle ebenso für Forschung und Wissenschaft wie für Heimat- und Familienforscher. Damit gewinnen Siegerland und Wittgenstein einen hoch zu bewertenden „kulturellen Standortfaktor“.
2. Im Landesarchiv Münster steht neuer Raum zur Verfügung. Durch die räumliche Nähe wird für das neue Landesarchiv die Betreuung der staatlichen Behörden im Kreisgebiet, die bisher von Münster aus erfolgt, erheblich vereinfacht. Dies bedeutet eine erhebliche Förderung der „kulturellen Daseinsvorsorge“, welche die Archive mit der Bildung der Überlieferung für folgende Generationen vornehmen. Weiterlesen
Reblog vom archivamtblog, 27.03.2025

„Der 24. Band der Veröffentlichungen der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. mit dem Titel “Adelsarchive im 21. Jahrhundert – Standortbestimmungen. Symposium anlässlich des 100-jährigen Bestehens des westfälischen Adelsarchivvereins” ist erschienen ….“
Regional ist folgender Beitrag besonders relevant:
Marcus Stumpf: Unruhige Zeiten: Die Fürsten Richard und Gustav Albrecht zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg in ihrer Rolle als Chef des Hausesin den 1920er Jahren, S. 257- 278
Link zum Inhaltsverzeichnis